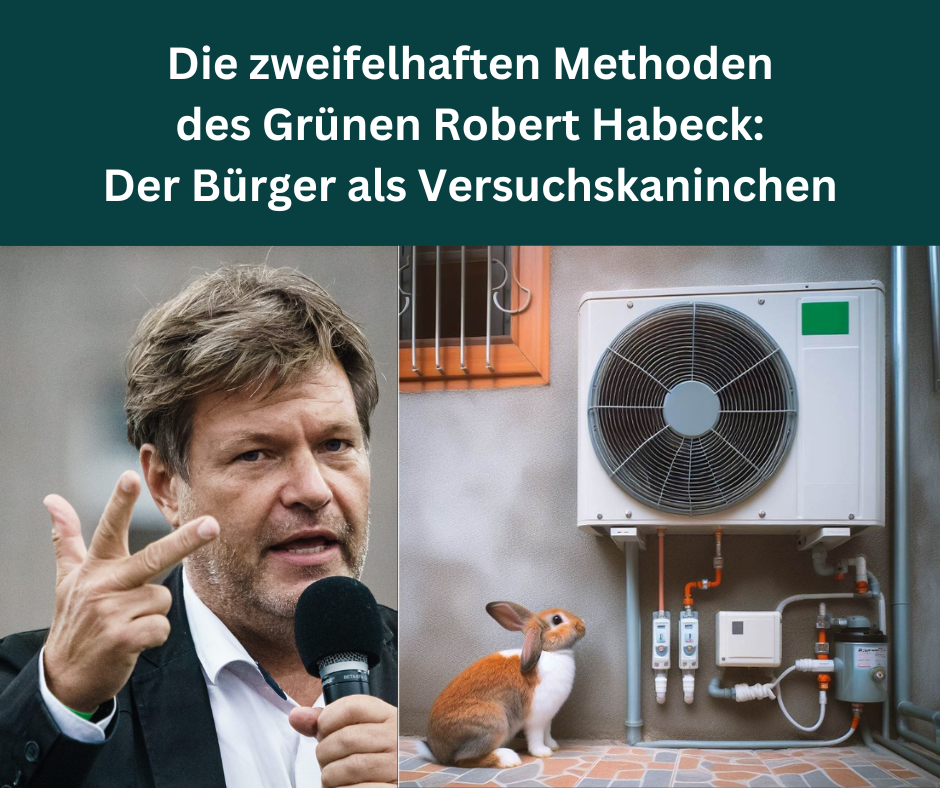Das sogenannte Heizungsgesetz, offiziell das Gebäudeenergiegesetz (GEG), hat die politische Landschaft in Deutschland erschüttert wie lange kein anderes Vorhaben der Ampel-Koalition. Ursprünglich als großer Wurf für den Klimaschutz gedacht, entwickelte es sich rasch zum Symbol für politische Entfremdung, überforderte Bürger und tiefsitzende Spannungen in der Regierung. Nun, da das Gesetz faktisch gescheitert ist, ist es Zeit für eine kritische Rückschau.
Ein Gesetz zu viel – oder zu früh?
Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, wollte mit dem GEG nichts weniger als eine Wärmewende einleiten. Gas- und Ölheizungen sollten durch klimafreundlichere Alternativen ersetzt werden, möglichst schnell und flächendeckend. Doch die Umsetzung stieß auf massive Kritik: zu komplex, zu teuer, zu schnell. Die Bevölkerung fühlte sich überrollt – und auch viele Kommunen und Handwerksbetriebe waren schlicht nicht in der Lage, die Vorgaben zu erfüllen.
Koalitionskrach und politische Erosion
Innerhalb der Ampel rieben sich SPD und FDP zunehmend an Habecks Vorschlägen. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sprach vom „Bürokratiemonster“, SPD-Bauministerin Klara Geywitz forderte eine radikale Vereinfachung, CDU und CSU kündigten an, das Gesetz im Fall eines Regierungswechsels vollständig zu kippen. Der Konsens in der Sache zerbröselte – und mit ihm der Rückhalt für Habecks Prestigeprojekt.
Ein Geständnis mit Sprengkraft
In einem späteren Interview räumte Habeck ein, dass es ihm auch darum gegangen sei, „die Bevölkerung zu testen“ – auszuloten, wie weit man mit ambitionierter Klimapolitik gehen könne, ohne den gesellschaftlichen Rückhalt zu verlieren. Ein bemerkenswerter Satz. Denn er offenbart eine politische Hybris, die am grünen Selbstverständnis nagt: Die Versuchung, nicht nur zu führen, sondern zu erziehen.
Was bleibt?
Was als notwendiger Schritt zum Klimaschutz begann, endete als Beispiel für überambitionierte Politik, die Realität und Akzeptanz unterschätzte. Der Gedanke des „Brauchen“ – was braucht die Gesellschaft, was braucht das Klima – wurde unter dem Gewicht des „Gesetzes“ erdrückt. Der Fall Habeck zeigt: Klimapolitik braucht nicht nur Ziele, sondern auch Gespür. Nicht nur Eile, sondern auch Demut.
Die Lektion: Wer führen will, darf nicht testen, sondern muss überzeugen.
Thomas Wild