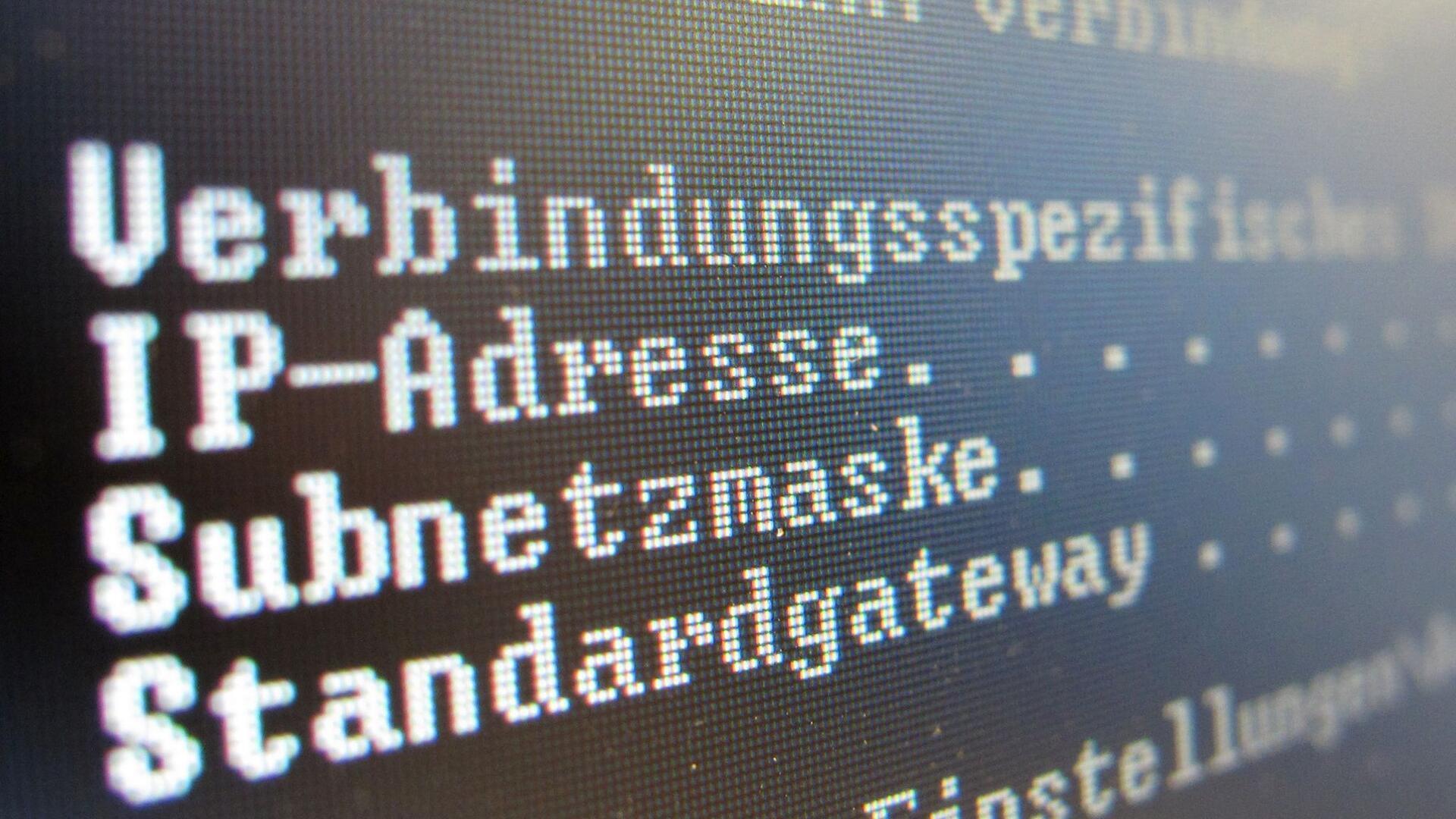Mike Zimmermann
Ein Rückblick auf den Grundrechtsschutz im digitalen Zeitalter
Die Vorratsdatenspeicherung war und ist eines der umstrittensten Instrumente der inneren Sicherheit in Deutschland. Ziel ist es, Telekommunikationsdaten präventiv zu speichern, um sie bei Bedarf zur Aufklärung schwerer Straftaten nutzen zu können. Doch diese Praxis stand früh unter verfassungsrechtlichem Beschuss – insbesondere durch die Verfassungsbeschwerde von 2007, die zu einem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2010 führte.
Hintergrund: Was ist Vorratsdatenspeicherung?
Bei der Vorratsdatenspeicherung werden sogenannte Verkehrsdaten – also Informationen darüber, wer wann mit wem über welches Medium kommuniziert hat – ohne konkreten Anlass für mehrere Monate gespeichert. Dazu gehören etwa IP-Adressen, Anrufzeiten, Standortdaten oder E-Mail-Verbindungsdaten. Der Inhalt der Kommunikation bleibt davon unberührt, jedoch lassen sich durch die Metadaten weitreichende Persönlichkeitsprofile erstellen.
Die Klage von 2007
Im Jahr 2007 reichten über 34.000 Bürgerinnen und Bürger, darunter viele Prominente und Juristen, eine gemeinsame Verfassungsbeschwerde gegen das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung ein. Es war die bis dahin größte Massenklage in der Geschichte der Bundesrepublik. Auslöser war die Umsetzung der EU-Richtlinie 2006/24/EG in deutsches Recht, wonach Verbindungsdaten sechs Monate lang gespeichert werden sollten.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (1 BvR 256/08)
Am 2. März 2010 verkündete das Bundesverfassungsgericht sein Urteil: Die Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung in ihrer damaligen Form seien verfassungswidrig und nichtig. Damit wurde das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in seiner damaligen Ausgestaltung vollständig aufgehoben.
Begründungen des Gerichts
Das Bundesverfassungsgericht stützte seine Entscheidung im Wesentlichen auf folgende Argumente:
- Unverhältnismäßigkeit der Datenspeicherung
Die anlasslose und umfassende Speicherung von Telekommunikationsdaten stelle einen besonders schweren Eingriff in das Grundrecht auf Telekommunikationsfreiheit (Art. 10 GG) dar. Der Gesetzgeber habe es versäumt, die gespeicherten Daten ausreichend zu sichern und den Zugriff streng zu begrenzen. - Gefahr eines Überwachungsdrucks
Die Vorratsdatenspeicherung könne ein Gefühl permanenter Überwachung erzeugen, das zu einer „freiheitsgefährdenden Streuwirkung“ führe. Dies könne das Verhalten der Bürger verändern und die freie Entfaltung der Persönlichkeit beeinträchtigen. - Fehlende Zweckbindung und Transparenz
Das Gesetz ließ eine klare Zweckbindung vermissen. Es fehlten hinreichend genaue Regelungen darüber, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen auf die Daten zugegriffen werden dürfe. Auch die Betroffenenrechte – insbesondere die Benachrichtigungspflicht – seien unzureichend geregelt gewesen. - Datensicherheit nicht ausreichend gewährleistet
Das Gericht kritisierte auch die mangelnden technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Daten vor Missbrauch und unbefugtem Zugriff.
Konsequenzen und Nachwirkungen
Mit dem Urteil wurde das damalige Gesetz außer Kraft gesetzt. Eine neue gesetzliche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung ist seither mehrfach versucht, aber stets rechtlich angegriffen worden. Auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat später mehrfach betont, dass eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung mit dem europäischen Datenschutzrecht unvereinbar sei.
Fazit
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2010 war ein Meilenstein für den Schutz der Grundrechte im digitalen Zeitalter. Es machte deutlich, dass Sicherheitsgesetze, so wichtig sie sein mögen, stets in einem ausgewogenen Verhältnis zu den Persönlichkeitsrechten der Bürger stehen müssen. Die Debatte um die Vorratsdatenspeicherung ist damit keineswegs beendet – doch sie steht seither unter strengster verfassungsrechtlicher Beobachtung.