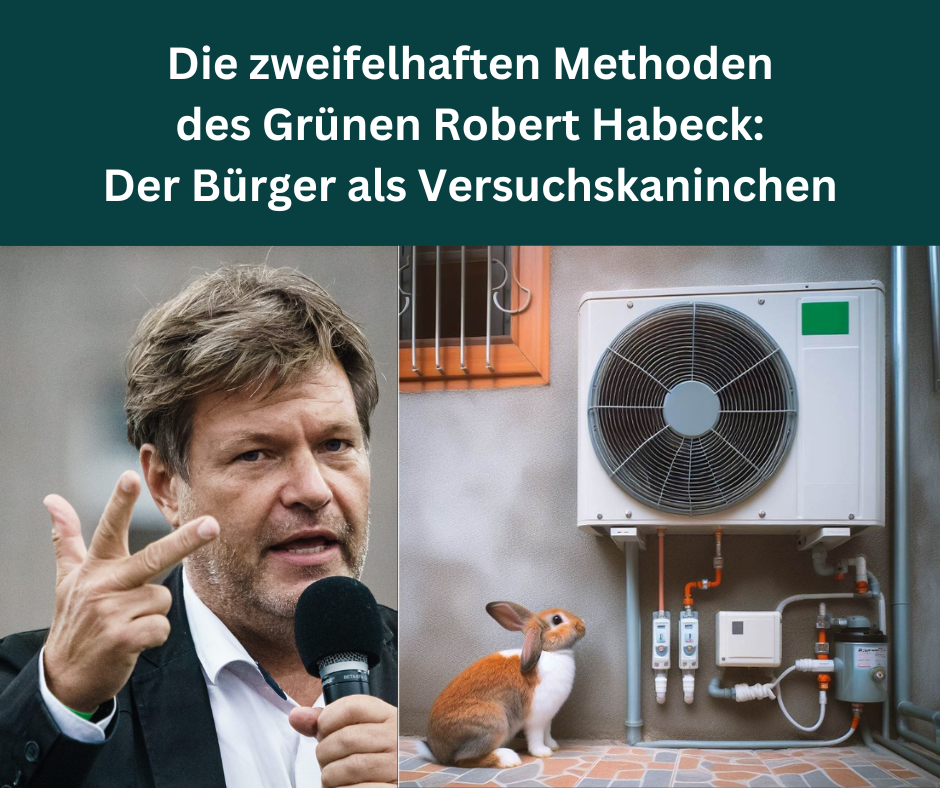Zwischen Strategie und Prinzipienverlust
Der aktuelle Migrationsstreit entlarvt ein grundlegendes Dilemma der Grünen: Die Partei, die einst als unerschütterliche Verteidigerin einer humanitären Flüchtlingspolitik galt, scheint im Wahlkampfgetöse ihre eigenen Überzeugungen zu verhandeln. Das Zehn-Punkte-Papier von Kanzlerkandidat Robert Habeck, das eine „Sicherheitsoffensive“ mit migrationspolitischen Verschärfungen kombiniert, offenbart nicht nur interne Risse, sondern wirft die Frage auf, ob die Grünen tatsächlich an einer progressiven Reform des Asylrechts interessiert sind – oder ob taktisches Kalkül ihre Prinzipien überrollt.
Habeck im Spagat: Sicherheitsrhetorik statt humanitärer Kompass
Habecks Forderungen lesen sich wie ein Zugeständnis an konservative Narrative: „Konsequente“ Abschiebungen nichtdeutscher Gefährder, „drastisch“ beschleunigte Asylverfahren und die rasche Umsetzung der umstrittenen EU-Asylreform (GEAS) sind Vorschläge, die eher an die Union oder gar die AfD erinnern als an eine Partei, die noch 2021 „eine Politik der offenen Herzen“ propagierte. Indem Habeck Migration und innere Sicherheit vermischt, bedient er genau jene vereinfachenden Debatten, die die Grünen lange kritisierten. Die Botschaft ist klar: Unter dem Druck sinkender Umfragewerte und der Unionsattacken setzt die Parteispitze auf Law-and-Order-Töne – und riskiert dabei die Glaubwürdigkeit ihrer eigenen Basis.
„Avance in Richtung Merz“: Empörung in den eigenen Reihen
Der Widerstand innerhalb der Partei ist laut. Ein Bundestagsabgeordneter nennt das Papier eine „Avance in Richtung Friedrich Merz“, während Katharina Müller von der Grünen Jugend betont, die Punkte hätten „nichts mit dem grünen Wahlprogramm zu tun“. Die Kritik entzündet sich nicht nur an der inhaltlichen Schärfe, sondern auch am Verfahren: Habeck agierte offenbar ohne breite parteiinterne Abstimmung, was als Versuch gewertet wird, sich als „starker Mann“ im Sicherheitsdiskurs zu profilieren. Doch genau dieser Alleingang untergräbt den basisdemokratischen Anspruch der Grünen, der einst ihre Identität prägte.
Sicherheit vs. Prävention: Ein grüner Widerspruch?
Besonders absurd wirkt Habecks Fokus auf Abschiebungen und Grenzkontrollen vor dem Hintergrund eigener Fachstimmen. Jan-Denis Wulff, Grünen-Mitglied und BKA-Kommissar, argumentierte jüngst, dass Sicherheit vor allem durch Prävention und soziale Maßnahmen erreicht werde – nicht durch symbolpolitische Härte. Doch statt diese Debatte zu führen, kopiert Habeck die Scheinlösungen der Rechten. Die geplanten „Kooperationspflichten“ zwischen Behörden und erweiterte Polizeibefugnisse klingen zudem nach staatlicher Überwachung, einem Thema, bei dem die Grünen eigentlich sensibilisiert sein sollten.
Opportunismus statt Überzeugung: Wem dienen die Grünen?
Das eigentliche Problem ist nicht die Anpassung an realpolitische Herausforderungen, sondern die Intransparenz des Kurswechsels. Wenn selbst Parteimitglieder betonen, es handle sich um „Habeck-Positionen, nicht Grünen-Positionen“, wird die Diskrepanz zwischen Führung und Basis unübersehbar. Die Partei riskiert, als Getriebene der Union wahrgenommen zu werden – und das ausgerechnet in einer Debatte, die ihre progressive Stimme dringend bräuchte. Statt eine eigenständige Vision für faire Asylverfahren oder die Entkriminalisierung von Migration zu entwerfen, reagiert sie mit Copy-Paste-Vorschlägen aus dem CDU-Handbuch.
Fazit: Zwischen Macht und Moral
Die Grünen stehen an einem Scheideweg: Wollen sie eine pragmatische Regierungspartei sein, die ihre Ideale der Macht unterordnet? Oder eine Bewegung, die auch unpopuläre Positionen vertritt? Habecks Sicherheitsoffensive wirkt wie ein Hilferuf an die Mitte – doch wer dabei seine Seele verkauft, verliert am Ende beides: Wähler*innen und Respekt. Wenn Migration nur noch durch die Sicherheitsbrille betrachtet wird, ist das nicht nur ein strategischer Fehler, sondern ein Abschied von jahrzehntelang erkämpften Werten. Die Grünen müssen sich entscheiden: Sind sie noch Teil der Lösung – oder bereits Teil des Problems?
Virginie Melan